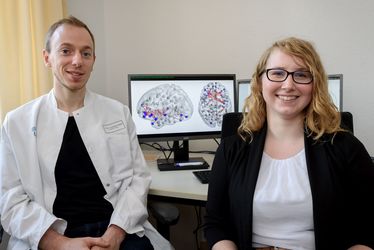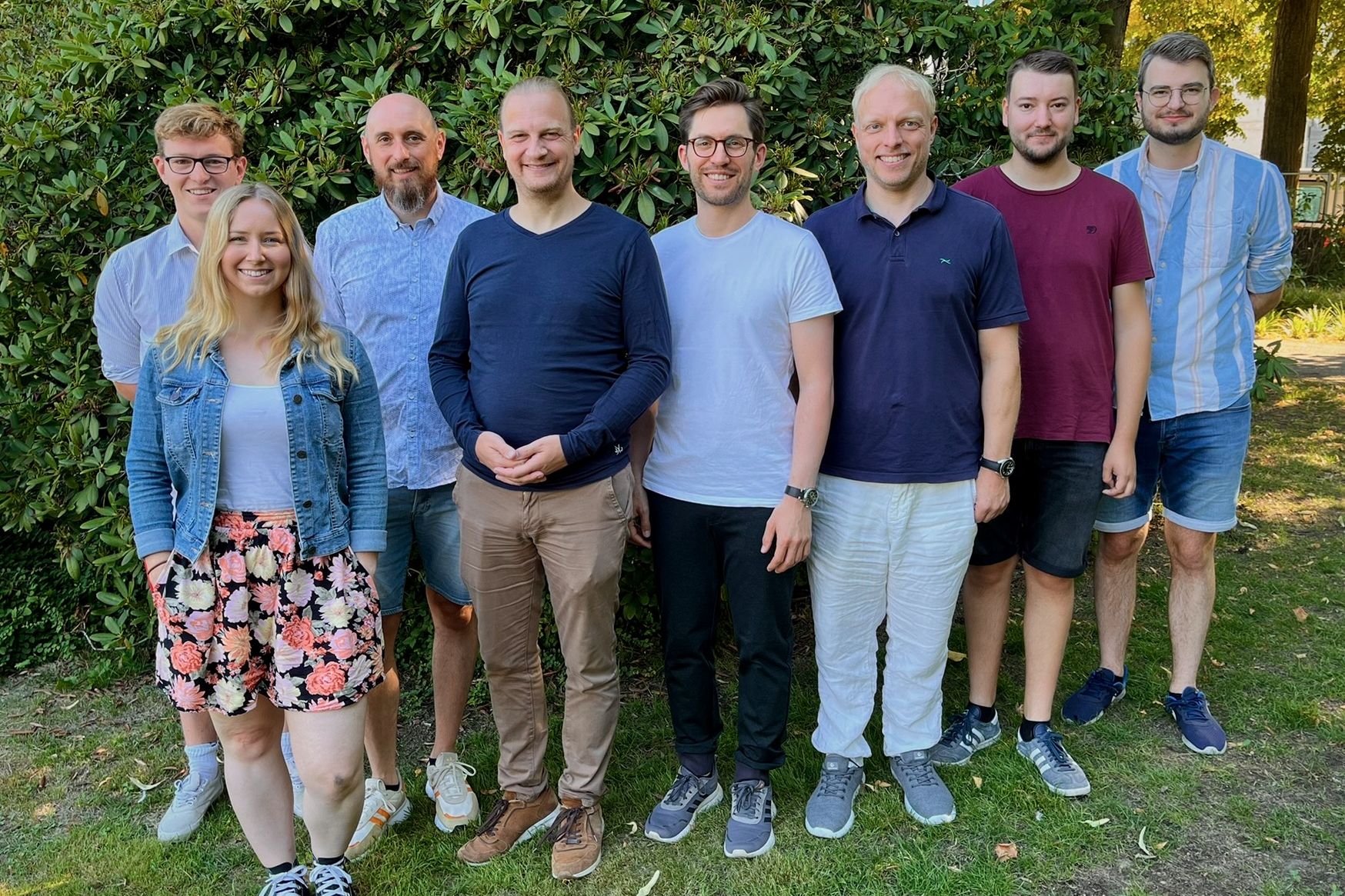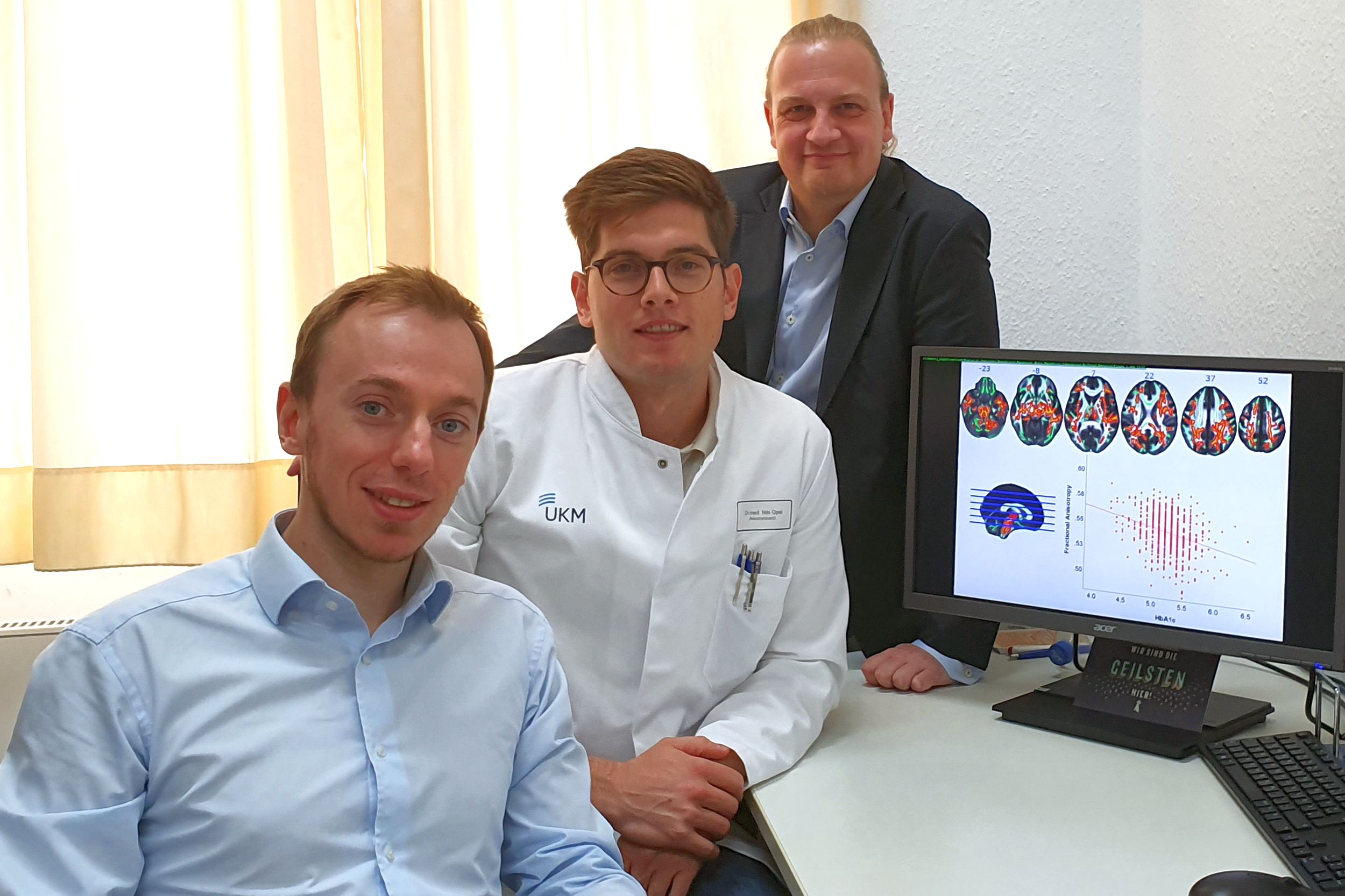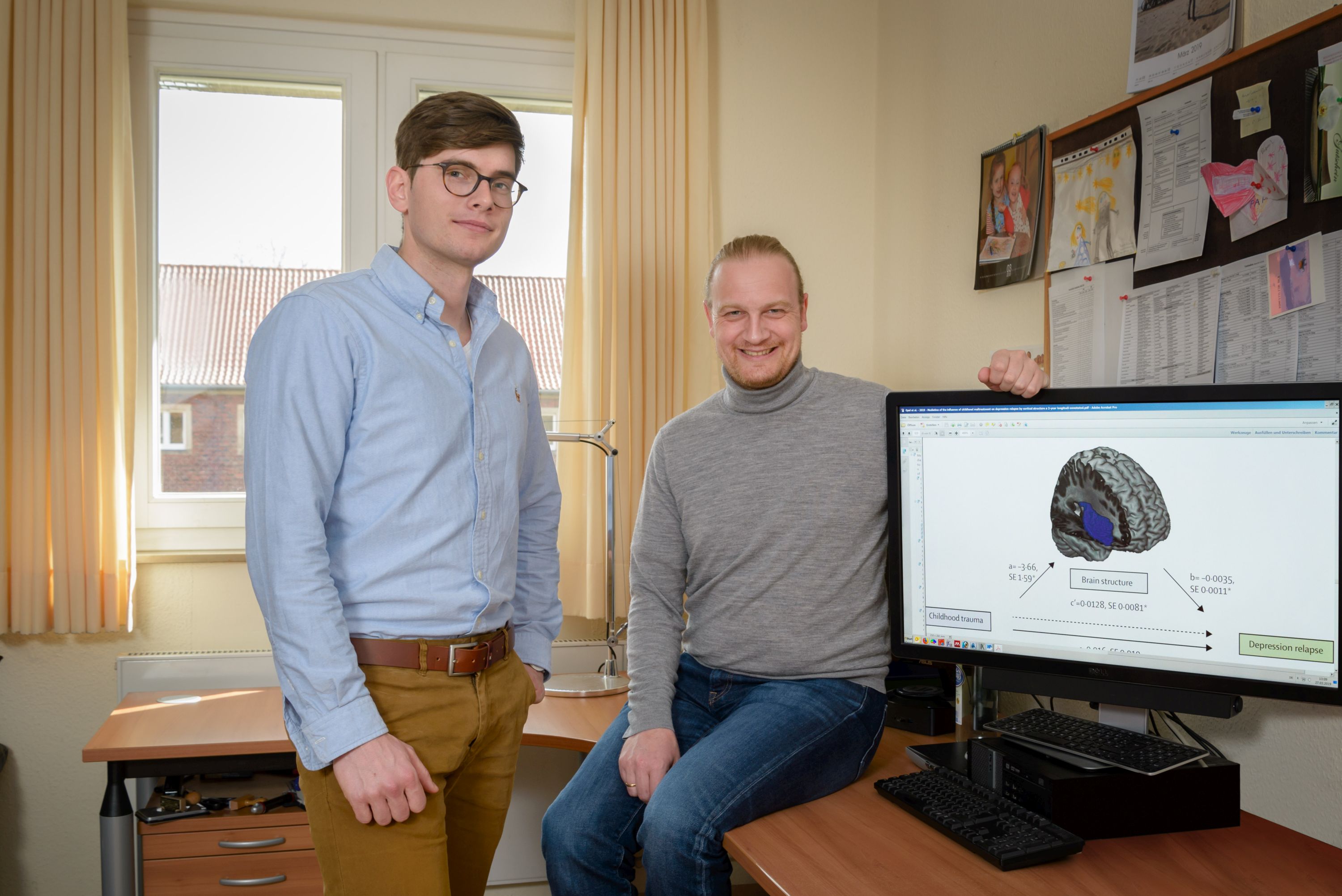News
Neurologische und psychiatrische Krankheiten zeigen ähnliche „Verbindungsfehler“: Studie bringt wichtige Erkenntnisse für Hirnforschung
Münster (mfm/sw) – „Stellen Sie sich das menschliche Gehirn als ein Flughafen-Netzwerk vor. Welche Verbindung ist dann die schnellste von Münster nach Sydney? Und wo sind die Knotenpunkte? Genau solche Überlegungen sind auch für den Aufbau des Gehirns relevant und werden durch die sogenannte weiße Substanz vermittelt“. Für das, was eine internationale Studie erforscht hat, wählt Dr. Jonathan Repple von der Universität Münster (WWU) gern das Airport-Beispiel. Um derartige Netzwerke besser zu verstehen, verwendet man in der Mathematik die Graphentheorie-Analyse – eine Methode, die in der Medizin bisher eher unüblich ist. Dank gleichartiger Netzwerk-Struktur kann das Verfahren mittlerweile aber auch auf das Gehirn angewendet werden – mit dem Resultat wichtiger neuer Erkenntnisse. Drei Forscher der WWU waren beteiligt an einer niederländischen Studie zur Konnektivität, also der Verbindung von Nervenzellen im Hirn. Die Ergebnisse erschienen nun in der renommierten Fachzeitschrift „Nature Human Behaviour“.
Neurologische und psychiatrische Erkrankungen: Beide haben ihren Ursprung vermeintlich im Gehirn. Was diese verschiedenen Arten von Erkrankungen aber wirklich unterscheidet – oder auch eint – war Gegenstand des von Siemon de Lange, Mitarbeiter der Universität Amsterdam und Erstautor der Studie, geleiteten Forschungsprojektes. Dessen Fokus lag auf der weißen Substanz im Hirn; hierbei handelt es sich um Fasermasse im zentralen Nervensystem, die die Funktion von Leitungsbahnen übernimmt. Die zentralen Verknüpfungspunkte darin, auch Hubs genannt, sind dabei besonders wichtig. „Unter ihnen gibt es überproportional häufig Verbindungen und diese bilden somit den sogenannten Rich-Club“, so Repple.
Der Assistenzarzt am Institut für Translationale Psychiatrie des Universitätsklinikums Münster bildete mit Institutsdirektor Prof. Udo Dannlowski sowie der Doktorandin Susanne Meinert den münsterschen Part der Studie. Um das Hirn-Netzwerk genau zu untersuchen und zu verstehen, wie und wo die Verbindungen bei einer bestimmten Erkrankung gestört sind, bediente sich der grenzübergreifende Forscherverbund der Graphentheorie-Analyse, einem Verfahren, dessen Einsatz in der Hirnforschung in den letzten Jahren vor allem durch den Letztautor der Studie, Prof. Martijn van den Heuvel von der Universität Amsterdam, etabliert wurde.
Getestet wurden rund 1.000 Patienten und zwölf Krankheitsbilder – davon acht psychiatrische und vier neurologische Erkrankungen, wie Schizophrenie, Depression, Alzheimer und ALS. Aufgrund der dortigen langjährigen Arbeiten auf diesem Gebiet konnte Münster einen Großteil der Daten von depressiven Patienten zur Verfügung stellen. Grundlage der Auswertungen war das bildgebende Verfahren der Magnetresonanztomographie (MRT). Die Wissenschaftler hatten bei jeder der zwölf Erkrankungen eine Störung der weißen Substanz erwartet, und zwar ganz unterschiedliche. Das Ergebnis erbrachte ein neues Verständnis von psychiatrischen Erkrankungen: Völlig unabhängig von der einzelnen Krankheit zeigte die Graphentheorie-Analyse bei jeder Erkrankung eine Störung insbesondere der „Rich-Club“-Faserverbindung – egal, ob es sich um eine neurologische Krankheit wie ALS handelt oder aber um eine psychiatrische wie die Schizophrenie. Eines haben die Krankheiten also gemeinsam: eine gravierende Störung der Faserverbindungen – und damit eine ähnliche Pathophysiologie.
„Das ist extrem wichtig und erkenntnisbringend für die weitere Forschung“, freut sich Repple. „Außerdem trägt es seinen Teil dazu bei, dass psychische Krankheiten in der Gesellschaft weiter entstigmatisiert werden können - indem man zeigt, dass auch psychische Erkrankungen ähnliche Hirnveränderungen aufweisen wie neurologische Krankheiten, nämlich defekte Verbindungswege.“ Zwar verhülfen die Ergebnisse nicht direkt zu einem neuen Therapieansatz, doch ermöglichten sie ein besseres Verständnis von den bislang noch unzureichend erforschten psychischen Krankheiten, sagt der münstersche Forscher – und fügt an: „Defekte Leitungsbahnen sind nicht irreversibel: Nach einer erfolgreich behandelten Depression kann die Konnektivität wieder verbessert werden. Ziel künftiger Forschungen am Institut für translationale Psychiatrie wird also sein, inwiefern Therapien die Verbindungen im Gehirn nach einer psychischen Erkrankung verbessern können“.