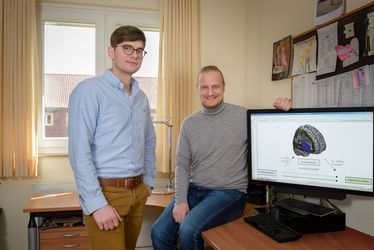News
Kindheitstrauma kann Gehirnstruktur beeinflussen und spätere Veranlagung zu schweren depressiven Störungen schaffen
Hirnbildgebung zeigt Verbindungen zwischen Misshandlung in der Kindheit, Gehirnstruktur und Anfälligkeit für schwere Krankheitsverläufe bei Depressionen auf
Münster (mfm) - Ein Trauma in der Kindheit kann die Struktur des Gehirns so beeinflussen, dass die Wahrscheinlichkeit von schweren, wiederkehrenden klinischen Depressionen im Erwachsenenalter steigt. Das ist das Ergebnis einer zweijährigen Beobachtungsstudie mit 110 Patienten, die Wissenschaftler der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) durchgeführt haben. Seine Ergebnisse hat das Forscherteam in der April-Ausgabe des Fachjournals The Lancet Psychiatry veröffentlicht.
Einige frühere Studien hatten auf eine mögliche Verbindung zwischen Misshandlung und veränderter Gehirnstruktur hingedeutet, während in anderen ein Zusammenhang zwischen Misshandlung und schweren depressiven Störungen identifiziert wurde. In der jetzt publizierten Studie wird erstmals eine direkte Verbindung zwischen dem Erleben von Misshandlungen, Veränderungen in der Gehirnstruktur und dem klinischen Verlauf einer Depression aufgezeigt. Zudem beleuchtet diese Studie als erste, um welche strukturellen Veränderungen im Gehirn es sich handeln könnte: So genannte „limbische Narben“ wurden bereits früher in Patienten identifiziert, sie hatten allerdings eine andere Form als die Veränderungen, die die WWU-Forscher feststellten.
Alle Teilnehmer der Studie hatten ein Alter zwischen 18 und 60 Jahren, waren nach der Diagnose einer schweren Depression in der Klinik aufgenommen worden und in stationärer Behandlung. Sie wurden zwischen 2010 und 2016 für die Teilnahme an der Studie gewonnen. Die Schwere ihrer Symptome bewerteten die Wissenschaftler mithilfe von Fragebögen und mit Gesprächen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, eines bei der ersten Einwilligung und eines zwei Jahre danach. Bei der Einwilligung durchliefen die Probanden auch einen strukturellen MRT-Scan, also eine Untersuchung mittels des Bildgebungs- und Diagnoseverfahrens der Magnetresonanztomographie. Zudem wurden mittels eines Fragebogens das Vorhandensein und das Ausmaß von Misshandlungen in der Kindheit ermittelt.
Die MRT-Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl Misshandlungen in der Kindheit als auch wiederkehrende Depressionen eine Verbindung haben zu ähnlichen Reduktionen in der Oberfläche der Inselrinde – dem Teil des Gehirns, der für die Regulierung von Emotionen und Selbstwahrnehmung mitverantwortlich zu sein scheint. Die Ergebnisse deuten ferner darauf hin, dass diese beobachtete Reduktion einen späteren Rückfall wahrscheinlicher machen könnte. Misshandlung in der Kindheit gehört zu den stärksten Risikofaktoren für schwerwiegende Depressionen.
“Noch mehr Gewicht bekommt durch unsere Ergebnisse die Vermutung, dass Patienten mit einer klinischen Depression, die als Kinder misshandelt wurden, klinisch anders zu betrachten sind als nicht-misshandelte Patienten mit gleicher Diagnose“, betont Dr. Nils Opel. Der Mitarbeiter des Instituts für Translationale Psychiatrie leitete das Forschungsprojekt. „Wenn man die Auswirkung der Inselrinde auf die Hirnfunktionen berücksichtigt, beispielsweise auf die emotionale Selbstwahrnehmung, ist es möglich, dass die von uns beobachteten Veränderungen das Ansprechen von Patienten auf konventionelle Behandlungen vermindern. Die künftige psychiatrische Forschung sollte daher untersuchen, wie sich unsere Ergebnisse einsetzen lassen, um Betreuungs- und Behandlungsmaßnahmen zu optimieren“.
Was Opel und Kollegen ebenfalls beobachteten: Misshandlung in der Kindheit war bei den Studienteilnehmern signifikant verbunden mit einem Rückfall in eine Depression. Die Patienten waren in zwei Gruppen eingeteilt: diejenigen, die in den zwei Jahren keinen Rückfall erlitten hatten, andererseits die mit mindestens einer zusätzlichen depressiven Episode. Von den 75 Menschen in der „Rückfall-Gruppe” berichteten 48 von einer zusätzlichen Episode, sieben von zwei und sechs sogar von drei, während 14 eine Remissionsperiode von weniger als zwei Monaten hatten und daher als Patienten mit einer chronischen Depression betrachtet werden konnten.
Mit ihrem Ansatz unterscheidet sich die münstersche Studie erheblich von früheren Forschungsprojekten, die auf Längsschnitte setzten und lediglich den klinischen Zustand zum Zeitpunkt des Folgetermins untersuchten. Klinische Symptome zwischen den Bewertungen fielen dabei durch das Raster. Bei der neuen Studie haben die Forscher Informationen zu depressiven Symptomen über den gesamten Zeitraum von zwei Jahren bewertet. Die Autoren weisen aber darauf hin, dass sich eine andere Einschränkung nicht ausschalten ließ: Eine in der Kindheit erlebte Misshandlung sowie depressive Symptome wurden von den Betroffenen retrospektiv bewertet, somit könnten sie einer Erinnerungsverzerrung unterliegen.
Gefördert wurde die Arbeit der WWU-Wissenschaftler von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie dem Interdisziplinären Zentrum für Klinische Forschung und dem Dekanat der Medizinischen Fakultät der Universität Münster.