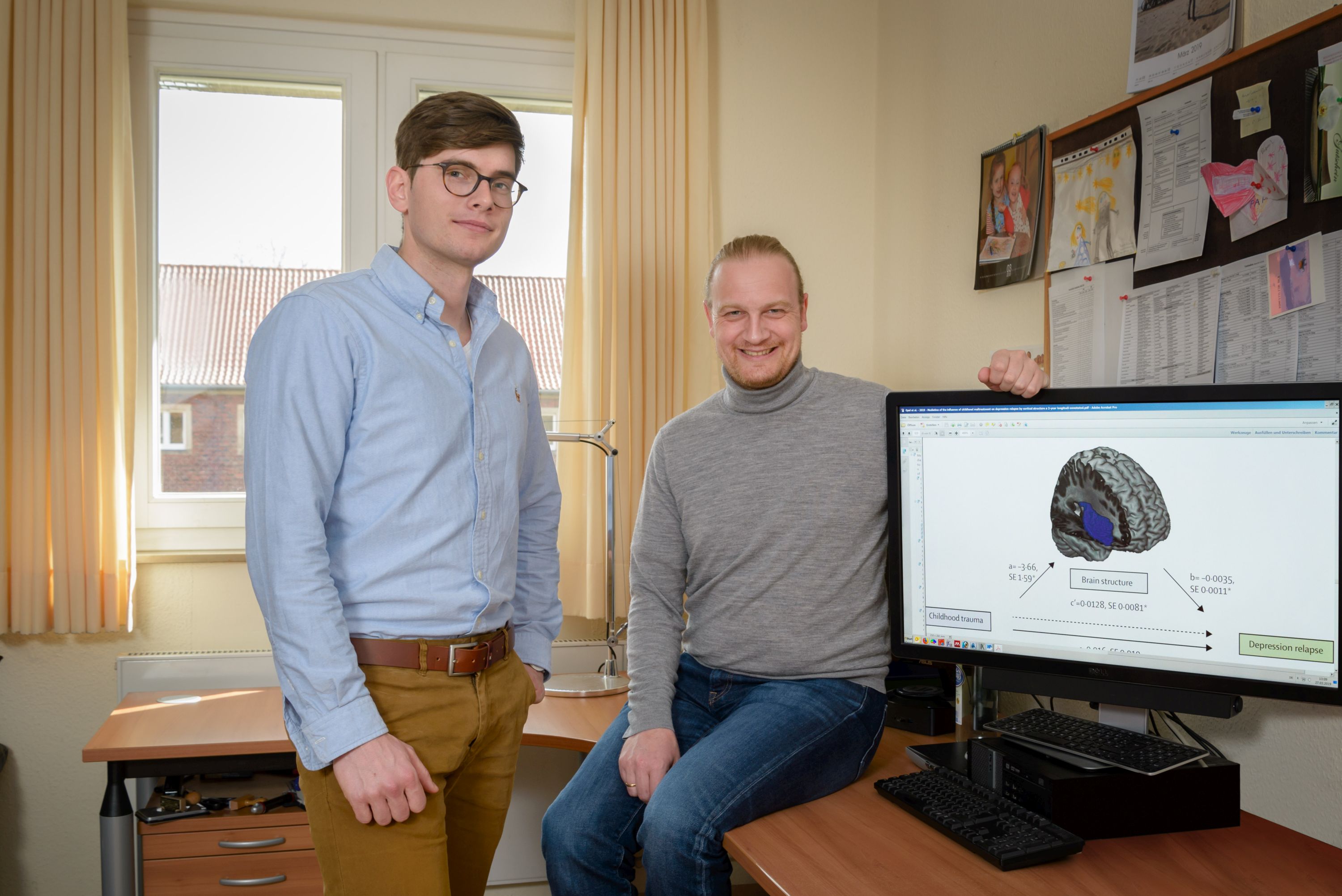News
Zwei münstersche Studien beteiligt: Groß angelegte Metaanalyse belegt Zusammenhang von 102 Genen und Risiko einer Depression
Münster (mfm/sw) – Depressionen gehören zu den häufigsten Volkskrankheiten weltweit. Immer mehr Betroffene leiden unter Antriebslosigkeit, Leistungsabfall und hinzukommenden körperlichen Beschwerden. Dass psychische Erkrankungen wie Depressionen auch vererbt werden können, ist heute zwar bekannt, jedoch noch nicht ausreichend erforscht. Prof. Klaus Berger, Direktor des Instituts für Epidemiologie und Sozialmedizin der Universität Münster, und Prof. Udo Dannlowski, Leiter der Abteilung für Translationale Psychiatrie am Uniklinikum, sowie 39 weitere Autoren weltweit haben sich in einer Metaanalyse, die den gesamten Gen-Pool des Menschen und drei veröffentlichte Studien einschließt, mit dieser Frage auseinandergesetzt. Das Ergebnis der jetzt in der „Nature Neuroscience“ erschienenen Analyse: Es gibt einen Zusammenhang zwischen 102 Genen und der Auftretenswahrscheinlichkeit von Depressionen.
Etwa 15 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung erleben mindestens einmal im Leben eine depressive Episode. Neben fordernden Lebensumständen, wie einer Trennung oder dem Tod eines nahen Angehörigen, kann unser Erbgut mitverantwortlich sein. Für einige Erkrankungen gibt es ein bestimmtes Gen, das die Krankheit auslöst, wenn es vererbt wurde. Prof. Klaus Berger erklärt zum Forschungsstand: „Die Wissenschaft suchte zunächst auch das eine Gen für die Depression, aber schnell wurde klar, dass es dieses nicht gibt, sondern das Zusammenspiel zahlreicher Gene entscheidend ist.“
Die Zahl der bisher ermittelten Gene, die klar mit einer Depression zusammenhängen, steigt kontinuierlich an. In der neuen Metaanalyse wurden Daten aus vorherigen Analysen – die insgesamt rund 800.000 Probanden einschließen - zusammengetragen und die Überlappung von 102 genetischen „Markern“ untersucht. „Nur durch so große Stichproben kann die nötige statistische Basis erzielt werden, um einen Effekt, der für jeden Marker sehr klein ist, zu berechnen“, erklärt Berger die Vorgehensweise.
Die Frage, die sich die Forscher im zweiten Schritt stellten: Wie hoch ist die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Depression bei den 102 Markern? Dazu wurde ein sogenannter „genetischer Risiko-Score“ berechnet. Dieser setzt sich zusammen sich aus der Summe der vererbten Varianten der 102 Marker: Für jeden der Marker wird eine Zahl zwischen 0 und 2 vergeben; entweder hat man keine Variante des Gens geerbt (entspricht: 0), eine vom Vater oder von der Mutter (jeweils: 1) oder von beiden Elternteilen (2). Um der entscheidenden Frage näher zu kommen, ob jemand, der einen so berechneten Risiko-Score von zum Beispiel 20 oder 30 hat, ein höheres Risiko in sich trägt, in seinem Leben an einer Depression zu erkranken, wurde der genetische Risikoscore dann auf Daten aus drei Studien angewendet. Gleich zwei davon liefen beziehungsweise laufen an der Universität Münster: das „BiDirect“-Projekt von Bergers Institut und die „Münster-Kohorte“, einer Studie, die von Prof. Udo Dannlowski betreut wird.
Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem genetischen Risiko-Score und dem Auftreten einer Depression. Bei den Probanden der „BiDirect“-Studie erklärt dieses Zusammenspiel etwa drei Prozent der Risikowahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken. Statistisch umgerechnet auf die Studienteilnehmer bedeutet das: Bei jenen, die einen besonders hohen Risikoscore, das heißt, viele Varianten ererbt haben, steigt das Risiko einer Depression um das Dreieinhalbfache.
„Die Ergebnisse sind ein bedeutender Fortschritt für das biologische Verständnis der Erkrankung“, so Prof. Berger. Dies sieht die bekannte wissenschaftliche Zeitschrift „Nature Neuroscience“ ähnlich und veröffentlichte die Metaanalyse. Zwar gibt der münstersche Forscher zu bedenken, dass die Analyse für die Therapie zur Zeit noch wenig praktische Neuerungen bringt, stellt aber zugleich fest, dass „die Klärung der Entstehung der Depression enorm wichtig ist, da so auch neue oder optimierte Therapieansätze gefunden werden.“