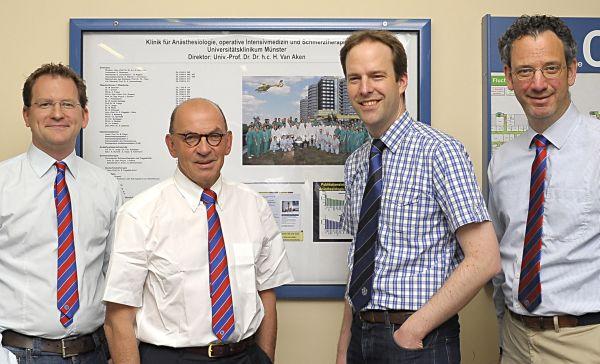News
Geschlechterunterschiede gibt es auch nach der OP: „PAIN-OUT“-Register zur Schmerzbehandlung wird fortgeführt
Berlin/Münster – Der offizielle Abschluss ist nicht das Ende: Ab Donnerstag (22.11.) stellen in Berlin 17 Kooperationspartner aus neun europäischen Ländern die Ergebnisse von „PAIN OUT“ vor. Mit dem zweitägigen Symposium endet die Förderphase des Projektes, bei dem es um eine verbesserte Behandlung postoperativer Schmerzen geht. Doch für die Teilnehmer steht bereits fest, dass sie das Projekt in eigener Regie fortführen werden. Zu den Hauptbeteiligten von PAIN OUT gehört auch Prof. Dr. Esther Pogatzki-Zahn von der Universität Münster.
Jährlich werden in Deutschland ca. 13 Millionen Operationen durchgeführt, weltweit sind es etwa 250 Millionen. 30 bis 50 Prozent der Patienten berichten über moderate oder starke Operationsschmerzen. Diese können zu Komplikationen führen, die Liegedauer verlängern sowie chronische Schmerzen verursachen und stellen damit einen großen Kostenfaktor dar. Um die Behandlung postoperativer Schmerzen zu optimieren, starteten die Schmerzmediziner des Universitätsklinikums Jena 2008 gemeinsam mit 16 Partnern das Projekt „Improvement in postoperative pain outcome“, kurz: PAIN OUT. Die Europäische Kommission förderte die Aufbauphase mit fast drei Millionen Euro.
Das Register enthält Informationen zu Operation, Anästhesie, Schmerztherapie und Nebenerkrankungen. Bisher wurden Daten von 35.000 Patienten gesammelt und mehr als 50 Kliniken haben sich dem Projekt angeschlossen, darunter Krankenhäuser in Asien, Afrika und Nordamerika. „Wir erfassten dabei auch, wie die Patienten selbst die Qualität der Schmerztherapie, aber auch Nebenwirkungen einschätzten. Diese Patientenperspektive wurde bisher in medizinischen Registern kaum berücksichtigt“, so der Koordinator des PAIN-OUT-Projektes Prof. Dr. Winfried Meißner vom Uniklinikum Jena.
Die Daten in der bisher größten internationalen Datenbank zu postoperativen Schmerzen werden nun einerseits benutzt, um den Krankenhäusern, Ärzten und Pflegekräften ihren Therapieerfolg vergleichend zurückzumelden. Daneben können Ärzte das Register beispielsweise nach besonderen oder schwierigen Fällen durchsuchen und von der virtuell gespeicherten Erfahrung ihrer Kollegen profitieren. Schließlich versorgt eine Leitlinien-Bibliothek die Nutzer mit den weltweit aktuellsten Therapieempfehlungen.
Darüber hinaus ermöglicht das Register die Analyse der Wirksamkeit von Therapieverfahren im klinischen Alltag und bildet damit eine wichtige Datengrundlage für künftige Forschungs- und Qualitätsprojekte. Deren Diskussion wird einen Schwerpunkt des Abschlusssymposiums darstellen: „Solche Register sind ein wichtiges Element der in Deutschland oft vernachlässigten Versorgungsforschung; sie können die Versorgungsrealität abbilden und durch einen Ländervergleich gegenseitiges Lernen ermöglichen“, betont Winfried Meißner.
Zu den Schwerpunkten von PAIN OUT gehören auch ethnische und kulturelle Aspekte sowie Geschlechtsunterschiede der postoperativen Schmerzwahrnehmung und Behandlung. So konnte Prof. Dr. Esther Pogatzki-Zahn vom Universitätsklinikum Münster, Leiterin einer PAIN-OUT-Arbeitsgruppe, nachweisen, dass Frauen nach einer OP eine höhere Schmerzempfindlichkeit zeigen und mehr schmerzlindernde Mittel benötigen. „Zugleich sind sie mit der Schmerztherapie aber genauso zufrieden wie männliche Patienten“, so die Expertin.
Eine weitere Erkenntnis ihrer Studien: „Bei Frauen, die älter sind als 50 Jahre und bereits vor der OP unter chronischen Schmerzen litten, gibt es ein erhöhtes Risiko für einen starken postoperativen Schmerz“. Laut Pogatzki-Zahn resultiert hieraus die Anforderung an die Schmerztherapie, dass diese bei entsprechenden Patientinnen sehr individualisiert erfolgen müsse.
Darüber, dass PAIN OUT ein „Erfolgsmodell“ ist und nach dem Förderende weiterlaufen soll, sind sich die Beteiligten angesichts solcher Forschungserfolge einig. Sogar eine Ausweitung ist geplant: Ab 2013 steht die Teilnahme an der Datensammlung und dem Ergebnisfeedback weltweit allen Klinken zur Verfügung. Ziel ist die Bildung eines weltweiten Netzwerkes für klinische und Versorgungsforschung nach dem Vorbild des deutschen Schmerzregisters QUIPS, bei dem mittlerweile 150 deutsche Kliniken mitmachen.
Jährlich werden in Deutschland ca. 13 Millionen Operationen durchgeführt, weltweit sind es etwa 250 Millionen. 30 bis 50 Prozent der Patienten berichten über moderate oder starke Operationsschmerzen. Diese können zu Komplikationen führen, die Liegedauer verlängern sowie chronische Schmerzen verursachen und stellen damit einen großen Kostenfaktor dar. Um die Behandlung postoperativer Schmerzen zu optimieren, starteten die Schmerzmediziner des Universitätsklinikums Jena 2008 gemeinsam mit 16 Partnern das Projekt „Improvement in postoperative pain outcome“, kurz: PAIN OUT. Die Europäische Kommission förderte die Aufbauphase mit fast drei Millionen Euro.
Das Register enthält Informationen zu Operation, Anästhesie, Schmerztherapie und Nebenerkrankungen. Bisher wurden Daten von 35.000 Patienten gesammelt und mehr als 50 Kliniken haben sich dem Projekt angeschlossen, darunter Krankenhäuser in Asien, Afrika und Nordamerika. „Wir erfassten dabei auch, wie die Patienten selbst die Qualität der Schmerztherapie, aber auch Nebenwirkungen einschätzten. Diese Patientenperspektive wurde bisher in medizinischen Registern kaum berücksichtigt“, so der Koordinator des PAIN-OUT-Projektes Prof. Dr. Winfried Meißner vom Uniklinikum Jena.
Die Daten in der bisher größten internationalen Datenbank zu postoperativen Schmerzen werden nun einerseits benutzt, um den Krankenhäusern, Ärzten und Pflegekräften ihren Therapieerfolg vergleichend zurückzumelden. Daneben können Ärzte das Register beispielsweise nach besonderen oder schwierigen Fällen durchsuchen und von der virtuell gespeicherten Erfahrung ihrer Kollegen profitieren. Schließlich versorgt eine Leitlinien-Bibliothek die Nutzer mit den weltweit aktuellsten Therapieempfehlungen.
Darüber hinaus ermöglicht das Register die Analyse der Wirksamkeit von Therapieverfahren im klinischen Alltag und bildet damit eine wichtige Datengrundlage für künftige Forschungs- und Qualitätsprojekte. Deren Diskussion wird einen Schwerpunkt des Abschlusssymposiums darstellen: „Solche Register sind ein wichtiges Element der in Deutschland oft vernachlässigten Versorgungsforschung; sie können die Versorgungsrealität abbilden und durch einen Ländervergleich gegenseitiges Lernen ermöglichen“, betont Winfried Meißner.
Zu den Schwerpunkten von PAIN OUT gehören auch ethnische und kulturelle Aspekte sowie Geschlechtsunterschiede der postoperativen Schmerzwahrnehmung und Behandlung. So konnte Prof. Dr. Esther Pogatzki-Zahn vom Universitätsklinikum Münster, Leiterin einer PAIN-OUT-Arbeitsgruppe, nachweisen, dass Frauen nach einer OP eine höhere Schmerzempfindlichkeit zeigen und mehr schmerzlindernde Mittel benötigen. „Zugleich sind sie mit der Schmerztherapie aber genauso zufrieden wie männliche Patienten“, so die Expertin.
Eine weitere Erkenntnis ihrer Studien: „Bei Frauen, die älter sind als 50 Jahre und bereits vor der OP unter chronischen Schmerzen litten, gibt es ein erhöhtes Risiko für einen starken postoperativen Schmerz“. Laut Pogatzki-Zahn resultiert hieraus die Anforderung an die Schmerztherapie, dass diese bei entsprechenden Patientinnen sehr individualisiert erfolgen müsse.
Darüber, dass PAIN OUT ein „Erfolgsmodell“ ist und nach dem Förderende weiterlaufen soll, sind sich die Beteiligten angesichts solcher Forschungserfolge einig. Sogar eine Ausweitung ist geplant: Ab 2013 steht die Teilnahme an der Datensammlung und dem Ergebnisfeedback weltweit allen Klinken zur Verfügung. Ziel ist die Bildung eines weltweiten Netzwerkes für klinische und Versorgungsforschung nach dem Vorbild des deutschen Schmerzregisters QUIPS, bei dem mittlerweile 150 deutsche Kliniken mitmachen.